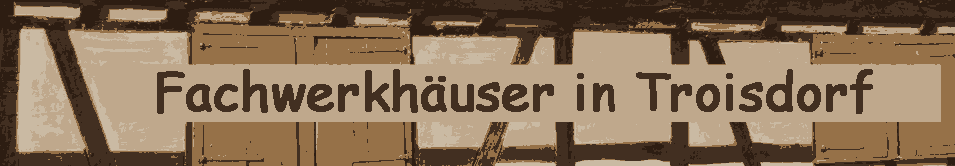Rheinstrasse 78 in Eschmar
Fährt man auf der Eschmarer
Dorfstrasse, die heute als
Hauptverkehrsader dient, findet man
nur noch wenige der alten
bäuerlichen Häuser, die in früherer
Zeit das Erscheinungsbild jedes
rheinischen Straßendorfes prägten.
Das Fachwerkhaus Rheinstrasse 78
ist eines davon. Es steht dort seit
über 200 Jahren und zeugt von
Baukunst und Lebensweise der
ländlichen Bevölkerung im 18.
Jahrhundert. Es ist aber nur deshalb
nicht verschwunden, weil die
Unterschutzstellung als Baudenkmal
vor Jahren seinen Abriss
verhinderte.
„Bedeutend für die Geschichte des
Menschen, erhaltenswert aus
wissenschaftlichen, besonders
architektur- und ortsgeschichtlichen
Gründen“ So steht es in der
Begründung der Denkmalbehörde. Ich
will im Folgenden versuchen zu
erläutern, was man sich darunter
vorstellen kann.

(Foto: Jensch)
„Das
Haus steht gut sichtbar nah an der
Straße, was zur Bauzeit den
Bedürfnissen entsprach, beim
heutigen Verkehrsaufkommen jedoch
nicht gerade ein Vorteil ist. Es
besteht aus zwei in L-Form
zusammengesetzten Baukörpern, die
recht verschieden konstruiert sind,
eigentlich nicht recht
zusammenpassen und sicher aus
unterschiedlicher Zeit stammen. Der
vordere, längs der Straße gelegene
Flügel, ein Stockwerkbau mit
geraden, geschoßhohen Streben wirkt
insgesamt moderner als der nach
hinten gerichtete Flügel mit seiner
Kombination aus gebogenen Fußstreben
und kurzen Gegenstreben. Auch die
Konstruktionsweise der original
erhaltenen Dachstühle unterstützt
diesen Eindruck. Vermutlich ist also
der hintere, ältere Teil damals
durch ein neues oder erneuertes
Vorderhaus ergänzt worden.
Interessante Details werden
sichtbar, wenn man die innere
Gestaltung der Gebäude vergleicht.
Das Vorderhaus zeigt den Aufbau
eines zeittypischen Wohnhauses mit
der damals für Wohnräume üblichen
Deckenhöhe von 2m. Völlig anders
stellt sich das Hinterhaus dar,
welches im Obergeschoss damals wohl
nur einen einzigen quadratischen
Raum von 30qm mit einer lichten
Deckenhöhe von stolzen 2,60m
aufwies. Ganz offensichtlich hat es
sich hier also nicht um ein normales
bäuerliches Wohnhaus gehandelt. Ein
Befund, der mit Blick auf die
Eschmarer Dorfgeschichte zu
Spekulationen über die mögliche
ursprüngliche Funktion veranlassen
kann. Es wäre zum Beispiel ein
Zusammenhang zum direkt benachbarten
ehemaligen Weingut denkbar, welches
repräsentative Räumlichkeiten für
Weinproben oder für die Bewirtung
hoher Gäste benötigte. Der darunter
befindliche, mit fast 20 qm recht
große, aus Ravensburger Brocken
gebaute Gewölbekeller mag ebenfalls
auf eine besondere Nutzung
hinweisen. Das Haus könnte somit
eine interessante Quelle für
ortsgeschichtliche Untersuchungen
darstellen.
Bauweise und Restaurierung
Das
Haus wurde ursprünglich komplett in
Fachwerkbauweise aus Eichenholz mit
Lehmgefachen errichtet. Im Laufe der
Jahrhunderte sind Teile des
Erdgeschosses durch Ziegelsteinwände
ersetzt worden. Zuletzt geschah
dies, nachdem im 2. Weltkrieg die
Nordostwand des Hauses durch die
Explosion einer Granate beschädigt
worden war. Die Spuren der
Granatsplitter in den Holzteilen der
Fassade sind im Obergeschoss noch
heute sichtbar.
In
den letzten Jahren wurde das Haus
grundlegend restauriert, wobei der
Grundsatz galt, die historische
Bausubstanz möglichst zu erhalten
und die notwendigen Reparaturen in
traditioneller Bauweise auszuführen.
Zur
Wiederherstellung der originalen
Holzkonstruktion wurden die nicht
mehr vorhandenen Eichenholzschwellen
im Erdgeschoss wieder ergänzt und
weitere fehlende oder zerstörte
Teile des Holzfachwerks durch
passende Reparaturstücke ersetzt.
Dazu wurden Eichenbalken aus einem
150jährigen Abrisshaus verwendet.
Von
den aus der Erbauungszeit
stammenden, aus Flechtwerk und
Strohlehm bestehenden
Gefachfüllungen konnten über 70%
erhalten werden, die übrigen wurden
in Lehmbauweise erneuert. Gleiches
gilt für die Geschoßdecken aus
Lehmwickelstaken. Zusätzlich erhielt
das gesamte Haus auf der Innenseite
eine Vorsatzwand aus wärmedämmendem
Holzleichtlehm, womit es seiner
Funktion als baubiologisch gesundes
Wohnhaus gerecht werden kann. Außen-
und Innenputz wurden nach
traditionellem Rezept aus Lehm bzw.
auf der Wetterseite aus Sumpfkalk
neu hergestellt. Aus nahe liegenden
Gründen wurden früher für den
ländlichen Hausbau bevorzugt solche
Baustoffe benutzt, die lokal
verfügbar waren. Auch bei der
Restaurierung wurde nun insofern
traditionell verfahren, als der
gesamte für die Herstellung der
Lehmwände und des Innen- und
Außenputzes verwendetet Lehm auf dem
eigenen Hausgrundstück ergraben
wurde.
Die
Fenster werden gerne als die Augen
eines Hauses bezeichnet.
Veränderungen daran haben einen
großen Einfluss auf das gesamte
Erscheinungsbild. Fenster sind ein
problematischer Punkt bei der
Restaurierung historischer
Wohngebäude, da ein sinnvoller
Kompromiss zwischen modernen
Bedürfnissen und dem Erhalt der
historischen Konstruktion leider oft
als nicht realisierbar angesehen
wird. In der Folge führt das dazu,
dass nur selten historische Fenster
eine Restaurierung überleben. Bei
genauem Hinsehen erwiesen sich die
im Hause noch erhaltenen, aus dem
19. Jahrhundert stammenden
Sprossenfenster aus Eichenholz dank
ihrer Holzdübel-Verbindungen als
reparaturfreundlich. Sie wurden
durch Austausch einzelner defekter
Rahmenteile repariert und konnten so
weiter verwendet werden. Durch den
zusätzlichen Einbau von
Vorsatzscheiben oder Vorsatzflügeln
wird eine zeitgemäße wärmetechnische
Verbesserung erreicht. Fehlende
Fenster wurden anhand der originalen
Vorbilder nachgebaut. Im Verbund mit
den ebenfalls restaurierten
Schlagläden konnte so die
konstruktive und optische
Originalität bewahrt werden.
Ursprünglich betrat man das Haus
durch eine zur Strasse gelegene
Haustür, die heute nicht mehr
existiert. Der quer durchs Haus
führende Flur ist aber noch
erkennbar. Um die ansonsten noch
weitgehend dem historischen Zustand
entsprechende Raumaufteilung im
Inneren des Hauses trotz notwendiger
Anpassungen an zeitgemäße
Wohnbedürfnisse möglichst nicht zu
verändern, wurden Kompromisse
gesucht. So wird z.B. die ehemalige
Räucherkammer heute als Duschkabine
genutzt. Weitere Zugeständnisse an
moderne Haustechnik wurden gemacht,
daneben aber erfüllen die originalen
Zimmertüren und die zweigeschossige
Holztreppe weiterhin ihre Funktion.
Auch die gemauerte Feuerwand ist
noch erhalten, und an der durch
Spuren des Kaminzuges erkennbaren
Position der ehemaligen offenen
Feuerstelle steht heute ein
Lehm-Grundofen.
Zur
Geschichte des Hauses
Über
die Geschichte des Hauses weiß man
nicht sehr viel. Wie so häufig im
bäuerlichen Leben sind keine
schriftlichen Überlieferungen
erhalten und das Wissen beschränkt
sich also auf Spuren der Nutzung
sowie die Erinnerung der noch
lebenden Bewohner.

 Unter
dem Holzfußboden des Wohnzimmers
wurden zwei alte Münzen gefunden,
ein ¼ Stüber der Grafschaft Wied von
1758 und ein ebenfalls aus dem 18.
Jahrhundert stammender Kölner
Heller. Sie sind ein Hinweis darauf,
dass das Haus zur Umlaufzeit dieser
Münzen sicherlich schon gestanden
hat. (Abb.?)
Unter
dem Holzfußboden des Wohnzimmers
wurden zwei alte Münzen gefunden,
ein ¼ Stüber der Grafschaft Wied von
1758 und ein ebenfalls aus dem 18.
Jahrhundert stammender Kölner
Heller. Sie sind ein Hinweis darauf,
dass das Haus zur Umlaufzeit dieser
Münzen sicherlich schon gestanden
hat. (Abb.?)
In
der Mitte des 19. Jahrhunderts
betrieben die Hausbesitzer eine
Ziegelei. Die zum Hof gehörenden
Stallungen wurden um 1850 aus
dortigen Steinen gebaut, und die
zugehörige, als ‚Webers Kuhl’
bekannte Lehmgrube ist noch heute im
Jägersgarten zu erkennen. Das Haus
soll später auch als
Schankwirtschaft gedient haben. Nach
Ende des 2.Weltkrieges wohnten
zeitweise 4 Parteien gleichzeitig im
Haus. Das älteste bekannte bildliche
Zeugnis des Hauses ist ein ca. 1930
entstandenes Foto, welches das Haus
noch komplett verputzt und mit
Hohlpfannendach zeigt. Die
inzwischen verschwundene vordere
Haustür ist sichtbar, und man
erkennt auch die heute noch
vorhandenen Schlagläden sowie das
eiserne Hoftor (Hinweis Abb.).
Heute präsentiert sich das Haus
Rheinstraße 78 als eine behutsam an
die Erfordernisse der modernen
Lebens- und Wohnbedürfnisse
angepasste, im Wesentlichen aber
noch dem alten Plan und der
historischen Bauweise entsprechende
Konstruktion. Es vermittelt Wissen
über traditionelle, noch immer
aktuelle biologische Baumethoden und
bewahrt Erinnerungen an unsere
eigene lokale Geschichte.

Abb.3: Foto ca.1930